|
Die Grabkirche in Deggendorf:
Massenwallfahrt brachte der Stadt eine gute
Einnahmequelle
 In
den etwa 400 m langen Deggendorfer Stadtplatz ragt die Grabkirche. Die
Synagoge stand genau dort, wo die Grabkirche (unvermittelt) in den
Stadtplatz hineinragt. In
den etwa 400 m langen Deggendorfer Stadtplatz ragt die Grabkirche. Die
Synagoge stand genau dort, wo die Grabkirche (unvermittelt) in den
Stadtplatz hineinragt.
Foto: Dezember 2003, v. Christine Kühnel,
Lizenzstatus: GNU FDL
Zur Entstehungsgeschichte erfahren wir in Georg
Dehios "Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler Band II Niederbayern
(pp.78): "Die am mittleren nördlichen Langhauspfeiler eingemeißelte
Inschrift gibt als Jahr des Baubeginns 1337 an. Sie stellt eine
Verbindung zwischen dem Baubeginn der Kirche und der Erschlagung der
Deggendorfer Juden her. Historische Tatsache ist, dass 1338 die
Handwerker der Stadt aus wirtschaftlichen Gründen (Schulden, Missernte)
die Juden ermordet und deren Ghetto (jetzt Michael-Fischer-Platz) in
Brand gesteckt haben. Die Synagoge stand dort, wo die Grabkirche
(unvermittelt) in den Stadtplatz hineinragt."
Beim
Bürgernetz Deggendorf e.V. finden sich weitere Angaben:
Wahrscheinlich viele Jahre nach dem Judenmord in Deggendorf entstand zur
Rechtfertigung des Pogroms eine Legende, die berichtet, die Juden hätten
10 geweihte Hostein gemartert, geschändet und in einen Brunnen geworfen.
Das Wasser sei so von den "Gottesmördern" vergiftet worden, wodurch
angeblich viele Christen beim Trinken des Wassers starben. Einem
neugeweihten Priester aus Niederalteich sei es schließlich gelungen, die
Hostien wunderbar zu bergen und in die Grabkirche zu überführen.
Die zur damaligen Zeit - nicht nur in Deggendorf - gängigen
Verdächtigungen, die Juden seien Hostienfrevler, waren bei den Christen
wahrscheinlich ein guter Grund, unliebsame Gläubiger umzubringen und
damit loszuwerden. Zitat aus genannter Legende: "Gott bewahre uns vor
diesem Judengeschmeiß".

Aus der Schedelschen Weltchronik von 1493. Der
Deggendorfer Hostienfrevel: "Das ellend iamerig und trostlose volck der
iuden... hat das allerhailigst sacrament vilfeltiglich gestochen ... do
warden die iuden ... mit gepürlicher peen des tods gestraft".
Die neu errichtete Grabkirche sollte Sühnekirche
für den angeblichen Hostienfrevel sein. 1401 gewährte Papst Bonifaz IX.
einen großen Ablass, die "Gnad", für fünf Tage nacheinander vom 30.09.
bis 04.10.. Die jetzt einsetzende Massenwallfahrt brachte der Stadt eine
gute Einnahmequelle.
Da sich immer mehr Kritik an dem Kult um die Gnad regte und die
Unhaltbarkeit der Hosteinlegende durch eine wissenschaftliche Arbeit
belegt wurde, stellten Ordinariat und Pfarramt die Gnad mit dem Jahr
1992 ein.
Der Benediktiner R. Bauerreiß hat 1931
über 117 "Hostienkirchen" zusammengestellt, darunter 33 mit sehr
ähnlicher Entstehungsgeschichte wie die der Deggendorfer Grabkirche:
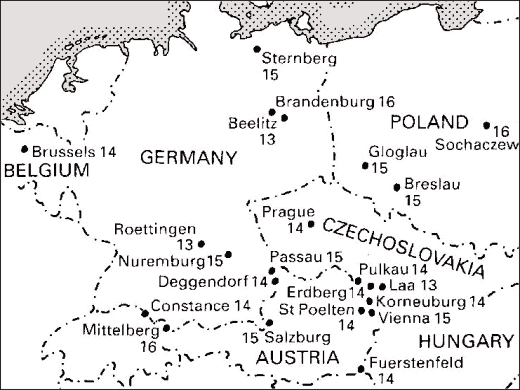
Einige Beispiele in Mitteleuropa (http://www.routledge.com)
Jahreszahl = Jahrhundert
Die mit dem Bau der Kirchen verbundenen
Hostien-Wallfahrten wiesen häufig Gemeinsamkeiten auf, die so weit
gingen, dass z.B. das Deggendorfer Wallfahrtslied fast wörtlich mit je
einem Passaus und Breslaus übereinstimmte.
Welche Bedeutung konsekrierte Hostien für die Menschen der damaligen
Zeit hatten, beweist auch die Inschrift der "Blinden Marter" in der
Stadt - Au in Deggendorf: "Bis zu dieser Säule drangen die Hussiten im
Jahre 1430 vor. Viermal versuchten sie zu stürmen, wichen aber durch den
Segen mit dem hl. Mirakel vor der Stadtmauer aus geblendet, entsetzt
zurück und zogen endlich ab".
Spagat oder Eiertanz:
Wallfahrt nach Heiligenblut
Nach vielen Jahren nimmt das Bistum Eichstätt
eine antijudaistische Wallfahrt wieder auf und distanziert sich zugleich
von ihr...
haGalil onLine - 01-12-2005 |